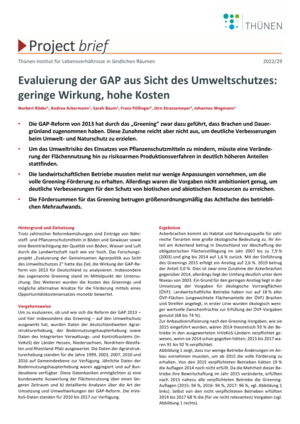Institut für
LV Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen
Projekt
Umweltwirkungen der Agrarreform von 2013 (GAPEval II)

Evaluierung der GAP-Reform von 2013 aus Sicht des Umweltschutzes anhand einer Datenbankanalyse von InVeKoS-Daten der Bundesländer (GAPEval II)
2013 / 2014 beschloss die EU-Kommission die Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP). Ziele sind eine gerechtere Verteilung der Agrargelder und eine umweltfreundlichere „grünere“ 1. Säule der GAP. Gründe für die Reform waren, dass dramatische Artenrückgänge in der Agrarlandschaft sowie anhaltend hohe Nährstoff- und Pflanzenschutzmitteleinträge (PSM) in Böden und Gewässer festgestellt wurden. Außerdem wurden freiwillige Agrarumweltmaßnahmen (AUKM) in intensiv genutzten landwirtschaftlichen Regionen relativ wenig in Anspruch genommen. Gegenstand des Forschungsvorhabens GAPEVAL II war es, die Auswirkungen der GAP-Reform auf den abiotischen Ressourcenschutz in Deutschland abzuschätzen. Außerdem sollten alternative Änderungsvorschläge zur Erreichung der Ziele erarbeitet werden. Das Projekt baute u. a. auf den Erkenntnissen des Vorgängerprojektes GAPEval auf.
Hintergrund und Zielsetzung
Ca. 1/3 des Gesamtetats der Europäischen Union wurde von 2014 bis 2020 für die GAP ausgegeben. Die Bundesrepublik Deutschland hat als größter Beitragszahler in dem EU-Gesamthaushalt ein großes Interesse daran, dass die öffentlichen Gelder wirksam und effizient eingesetzt werden. In Deutschland ist die Landwirtschaft der mit Abstand größte Flächennutzer, von dem eine Vielzahl positiver und negativer Umweltwirkungen auf Boden, Wasser, Luft, Klima und Biodiversität ausgehen.
Zum Zeitpunkt des Projektstarts wurde überlegt, ob und falls ja, wie die GAP nach 2020 aussehen soll. Doch bis dahin lagen nur wenige empirische Erfahrungen zur Wirkung der GAP-Reform von 2013 auf die Umweltgüter vor. Dies hatte verschiedene Gründe, von denen im Folgenden nur ein paar genannt werden sollen. Das Greening wurde erst 2015 eingeführt. Somit bestand für die Landwirte erst Anfang 2015 Klarheit, welche Auflagen sie konkret einzuhalten haben. Außerdem liefen in 2015 die Agrarumweltprogramme der Länder neu an. Zusammenfassend wird 2015 eher als Anpassungsjahr bewertet. Nach der Einführung des Greenings mussten Landwirte erst Erfahrungen sammeln, wie sie diese für sie neuen Instrumente am sinnvollsten umsetzen. Daher war davon auszugehen, dass manche Effekte erst nach mehreren Jahren auftreten. Diese wurden im Nachfolgeprojekt GAPEval II erfasst.
Das Forschungsprojekt hatte folgende Zielsetzungen:
Die umweltrelevanten Wirkungen der GAP-Reform wurden anhand eines Umweltindikatoren-Sets untersucht. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung der Effektivität und Effizienz der eingesetzten Mittel. Außerdem wurde eine räumlich differenzierte Analyse der Umsetzung flächengebundener ELER-Maßnahmen durchgeführt (ELER: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums). Des Weiteren fand eine Abschätzung der Kosten der einzelnen Greening-Maßnahmen auf betrieblicher Ebene statt. Abschließend wurden konkrete und praktikable Vorschläge auf Ebene der Instrumente und Maßnahmen zur Steigerung der gewünschten Umweltwirkungen erarbeitet.
Zielgruppe
Wissenschaft, Ministerien für Landwirtschaft und für Umwelt, Landwirte, Beratung, amtlicher Naturschutz, Agrarverwaltung, EU-Kommission
Vorgehensweise
Im ersten Arbeitsschritt wurden die InVeKoS-Daten in Hinblick auf folgende Aspekte untersucht:
- die Etablierung von ökologischen Vorrangflächen,
- die Umsetzung des Grünlandschutzes,
- die Kulturartendifferenzierung,
- sonstige abiotische Umweltfragen.
Im zweiten Arbeitsschritt wurde eine Abschätzung der Kosten des Greenings durch die Auswertung der Agrarstrukturerhebung 2016 und durch eine Betriebswirtschaftliche Analyse der Greening-Maßnahmen vorgenommen. Abschließend erfolgte die Auswertung und Interpretation der Analyseergebnisse sowie das Ableiten von Handlungsempfehlungen.
Das Julius Kühn-Institut für Strategien und Folgenabschätzung nahm zusätzlich eine regionalisierte Abschätzung des Umweltrisikos der Pflanzenschutzmittelanwendung vor.
Daten und Methoden
Zur Beantwortung unserer Forschungsfragen werden InVeKoS-Daten verschiedener Bundesländer für den Zeitraum von 2010 bis 2018 herangezogen. Dies erfolgt aufbauend auf den bereits gelaufenen Projekten zum Greening (LINK ZUM DACHPROJEKT). Gegenstand der Analysen sind die Entwicklung des Dauergrünlandes, die Umsetzung von Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) sowie der Kulturartendiversität. Letzteres wird nicht nur auf betrieblicher Ebene untersucht, sondern auch auf der Landschaftsebene, da durch die Zunahme der mittleren Betriebsgröße mit einer Steigerung der Kulturarten je Betrieb gerechnet wird. Des Weitern werden die Daten in Hinblick auf vier weitere Aspekte analysiert: die Entwicklung der Flächenausstattung und Arrondierung der Betriebe, des Wassererosionspotentials, der Humusbilanz sowie die Nutzung umweltsensibler Standorte. Um eine fundierte Analyse zu den aufgeführten Aspekten zu erstellen, werden neben den Greening-Maßnahmen auch die Agrar-Umwelt-und Klimamaßnahmen (AUKM) der Länder berücksichtigt.
Unsere Forschungsfragen
Etablierung von ökologischen Vorrangflächen
- Welchen Beitrag leisten die umgesetzten ÖVF-Optionen hinsichtlich Fragen des Erosionsschutzes, einer Veränderung der Humusbilanz sowie dem Austragsrisiko für Nähstoffe und PSM?
Umsetzung des Grünlandschutzes
- Welche Flächenverluste treten durch Umwandlung in andere landwirtschaftliche Nutzungen auf? Welche Rolle spielt dabei die Nicht-Beantragung bisher im InVeKoS registrierter Dauergrünlandflächen oder der Übergang in außerlandwirtschaftliche Nutzungsformen?
- Welche Unterschiede sind auf Ebene der Bodenklimaräume, Schutzgebietskulissen, verschiedener Standortparameter und Betriebstypen bei differenzierter Betrachtung erkennbar?
- Welche Entwicklungen sind im Zeitablauf zu beobachten (Nutzungsintensität, Grünlandfläche)?
Kulturartendifferenzierung
- Hat sich die Kulturartendiversität auf regionaler und lokaler Ebene geändert? Es werden neben Kulturarten im Sinne der DZ-VO auch funktionelle Gruppen (Blütenpflanzen, Winterungen, …) betrachtet.
- Gibt es dauerhafte Veränderungen der Anbauumfänge bestimmter Kulturen?
- Sind Änderungen in den Fruchtfolgen erkennbar?
Sonstige abiotische Umweltfragen
- Wie ist die Flächenausstattung der Betriebe; d.h. die Größe und Lage der einzelnen Schläge insgesamt und zueinander?
- Wie hoch ist das Wassererosionspotential bzw. die Erosionsgefährdung der Flächen?
- Überflutungsflächen: Wie hoch ist das Risiko bzw. was wären die Auswirkungen des direkten Eintrages von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln in aquatische Ökosysteme?
- Wie hoch sind die Humusgehalte im Boden?
- Wie ist die Entwicklung der Landnutzung an umweltsensiblen Standorten (organische Böden oder Überschwemmungsgebiete)?
Abschätzung der Kosten des Greenings
- Wie hoch sind die einzelbetrieblichen Anpassungskosten für das Greening?
- Inwieweit nehmen Betriebe Kürzungen der Greening-Zahlungen in Kauf?
- Wie müssen die Greening-Maßnahmen ausgestaltet werden, sodass die Umsetzung von Maßnahmen mit hohem Umwelteffekt für die Betriebe attraktiver wird? Welche Auswirkungen hätte es, wenn die Betriebe die Maßnahmen mit hohem Umwelteffekt vermehrt umsetzen würden?
- Werden die Fördermittel für Greening-Maßnahmen und Instrumente effizient eingesetzt?
- Wie kann die Effizienz des Greenings verbessert werden?
Ergebnisse
Die GAP-Reform 2013 führte zu geringfügigen Verbesserungen für Umwelt- und Naturschutz. Der Umfang der ökologisch wertvollen Flächen konnte gegenüber 2010 minimal erhöht werden, allerdings wurde das Niveau der frühen 2000er Jahre nicht erreicht. Auch bei der Vielfalt der Ackerkulturen und dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wurden kaum positive Veränderungen im Zuge des Greenings beobachtet. Die Ausgestaltung der Greening-Komponenten war nicht ambitioniert genug, um nennenswerte positive Effekte für die Umwelt zu bewirken.
Vor dem Hintergrund der verschiedenen Strategiepläne der EU dienen die Ergebnisse der Studie als Grundlage für eine nationale Ausgestaltung der GAP aus Sicht des Umweltschutzes. Das Ziel der Farm-to-Fork-Strategie, eine Halbierung der Verwendung und des Risikos von chemischen Pflanzenschutzmitteln, sollte nicht nur vor dem Hintergrund der ausgebrachten Menge und deren Toxizität betrachtet werden, sondern das Gefährdungspotenzial auch differenziert nach der Flächennutzung. Das zeigt die Analyse zum Umweltrisiko von Pflanzenschutzmitteln. In Hinblick auf die „Biodiversitätsstrategie für 2030“, in der ebenfalls die Verringerung der Schadenswirkung von Pflanzenschutzmitteln angestrebt wird, ergeben sich hierbei Synergieeffekte.
Eine kurze Zusammenfassung der Kernergebnisse finden Sie im Project Brief.
Links und Downloads
Vorgängerprojekt GAPEval: Evaluierung der GAP-Reform aus Sicht des Umweltschutzes
Thünen-Ansprechperson

Thünen-Beteiligte
Beteiligte externe Thünen-Partner
- Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI)
(Quedlinburg, Braunschweig, Groß Lüsewitz, Kleinmachnow, Deutschland)
Geldgeber
-
Umweltbundesamt (UBA)
(national, öffentlich)
Zeitraum
12.2017 - 12.2020
Weitere Projektdaten
Projektfördernummer: FKZ: 3717 11 2370
Förderprogramm: BMUB - Umweltforschungsplan
Projektstatus:
abgeschlossen
Publikationen zum Projekt
- 0
Röder N, Ackermann A, Baum S, Pöllinger F, Strassemeyer J, Wegmann J (2022) Evaluation of the CAP from an environmental perspective: low impact, high costs. Braunschweig: Thünen Institute of Rural Studies, 2 p, Project Brief Thünen Inst 2022/29a, DOI:10.3220/PB1658751288000
- 1
Röder N, Ackermann A, Baum S, Pöllinger F, Strassemeyer J, Wegmann J (2022) Evaluierung der GAP aus Sicht des Umweltschutzes: geringe Wirkung, hohe Kosten. Braunschweig: Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen, 2 p, Project Brief Thünen Inst 2022/29, DOI:10.3220/PB1658750958000
- 2
Röder N, Ackermann A, Baum S, Böhner HGS, Laggner B, Lakner S, Ledermüller S, Wegmann J, Zinnbauer M, Strassemeyer J, Pöllinger F (2022) Evaluierung der GAP-Reform von 2013 aus Sicht des Umweltschutzes anhand einer Datenbankanalyse von InVeKoS-Daten der Bundesländer : Abschlussbericht [online]. Dessau: Umweltbundesamt, 288 p, Texte UBA 75/2022, zu finden in <https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_75-2022_evaluierung_der_gap-reform_von_2013.pdf> [zitiert am 06.07.2022]
- 3
Röder N, Ackermann A, Baum S, Wegmann J, Strassemeyer J, Pöllinger F (2021) Geringe Umweltwirkung, hohe Kosten : Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt "Evaluierung der Gemeinsamen Agrarpolitik aus Sicht des Umweltschutzes II" [online]. Dessau: Umweltbundesamt, 26 p, Texte UBA 71, zu finden in <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/geringe-umweltwirkung-hohe-kosten> [zitiert am 04.05.2021]
- 4
Röder N, Ackermann A, Baum S, Wegmann J, Strassemeyer J, Pöllinger F (2021) Limited environmental impact and high costs : Findings and recommendations from the project "An Evaluation of the Common Agricultural Policy from the Perspective of Environmental Protection II" [online]. Dessau: Umweltbundesamt, 24 p, Texte UBA 76, zu finden in <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/limited-environmental-impact-high-costs> [zitiert am 11.05.2021]
- 5
Pe'er G, Bonn A, Bruelheide H, Dieker P, Eisenhauer N, Feindt PH, Hagedorn G, Hansjürgens B, Herzon I, Lomba A, Marquard E, Moreira F, Nitsch H, Oppermann R, Perino A, Röder N, Schleyer C, Schindler S, Wolf C, Zinngrebe Y, Lakner S (2020) Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges. People Nature 2(2):305-316, DOI:10.1002/pan3.10080
- 6
Röder N, Ackermann A, Baum S, Böhner HGS, Rudolph S, Schmidt TG (2019) Small is beautiful? Is there a relation between farmed area and the ecological output? - Results from evaluation studies in Germany : paper prepared for presentation at the 172nd EAAE Seminar "Agricultural Policy for the Environment or Environmental Policy for Agriculture?" ; May 28-29, 2019, Brussels. 15 p
- 7
Birkenstock M, Röder N (2018) Gestaltung und Umsetzung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik ab 2021 - Übersicht über die politischen Debatten. Dessau: Umweltbundesamt, 66 p, Texte UBA 108