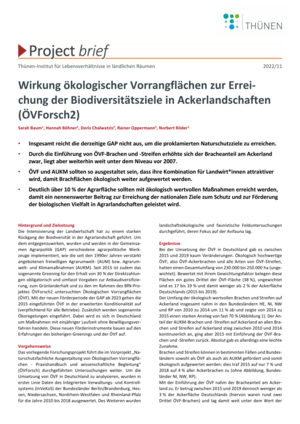Institut für
LV Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen
Projekt
Wirkung Ökologischer Vorrangflächen zur Erreichung der Biodiversitätsziele in Ackerlandschaften (OEVForsch2)

Die Biodiversität in der Agrarlandschaft unterliegt einem deutlichen Rückgang. Um dem entgegenzuwirken, ist ein Teil der Direktzahlungen aus der EU-Agrarpolitik seit 2015 an Greening-Auflagen gebunden. So müssen die meisten landwirtschaftlichen Betriebe mit mehr als 15 Hektar Ackerland 5% ihrer Ackerfläche im Umweltinteresse nutzen und sie als ökologische Vorrangflächen ausweisen. Aufbauend auf den Ergebnissen des Projektes OEVForsch (2015-2016) wurden im Rahmen dieses Projektes OEVForsch2 die Umsetzung und Wirksamkeit der ökologischen Vorrangflächen in der deutschen Agrarlandschaft untersucht.
Hintergrund und Zielsetzung
In der Agrarlandschaft werden starke Artenrückgänge sowie anhaltend hohe Nährstoffeinträge in Böden und Gewässer beobachtet. Für den Schutz der Umwelt und um den europäischen sowie globalen Vorgaben zum Schutz der Biodiversität nachzukommen, war es ein Ziel der EU-Kommission, mit der jüngsten Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) eine umweltfreundlichere „grünere“ 1. Säule (Direktzahlungen an Landwirte) zu etablieren. Denn die angebotenen freiwilligen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM), die über die 2. Säule der GAP finanziert werden, waren bis dahin in intensiv genutzten landwirtschaftlichen Regionen nur verhältnismäßig wenig in Anspruch genommen worden.
Seit 2015 müssen also die meisten Betriebe mit mehr als 15 Hektar Ackerfläche 5% als ökologische Vorrangfläche (ÖVF) ausweisen. Für die nationale Umsetzung können die EU-Mitgliedsstaaten verschiedene Flächentypen aus einer von der EU erstellten Liste auswählen. Die Flächennutzungstypen reichen von solchen, die eine Nutzung zulassen (z.B. für stickstofffixierende Pflanzen), bis hin zu Typen, auf denen keine Nutzung erlaubt ist (z.B. Brachflächen). Um Landwirten eine hohe Nutzungsflexibilität zu ermöglichen, können in Deutschland sehr viele Flächennutzungstypen als ÖVF ausgewiesen werden.
Gegenwärtig wird die ökologische Wirksamkeit der neuen Regulierung sowie die Verhältnismäßigkeit des Aufwands für Verwaltung und Kontrolle diskutiert. Erste Erkenntnisse zur ökologischen Wirksamkeit der ÖVF zeigten, dass ein Großteil tendenziell hochwertiger ÖVF (Brachen und Streifen) schon vorher in den Betrieben vorhanden war und dass diese eher von Großbetrieben gemeldet werden. Dadurch profitieren vor allem Arten, die in Gebüschen und Ruderalflächen heimisch sind (z.B. Dorngrasmücke, Sumpfrohrsänger, Stieglitz), nicht aber Arten, die sich in der der offenen Agrarlandschaft ansiedeln (z.B. Feldlerche, Schafstelze). Der positive Nutzen der ÖVF für die Biodiversität ist neben dem Typ außerdem von Faktoren abhängig wie konkreter Lage, Größe, Bewirtschaftung oder Pflege, benachbarten Flächen und Vernetzung.
Zielgruppe
Ministerien für Landwirtschaft und für Umwelt, Landwirte, Beratung, amtlicher Naturschutz, Agrarverwaltung, EU-Kommission
Vorgehensweise
InVeKoS-Daten der Bundesländer zur Landnutzung und zu Betriebskennzahlen wurden analysiert im Hinblick auf:
- die Umsetzung und Akzeptanz von Landwirten bezüglich der unterschiedlichen Greening-Optionen über die Zeit und mögliche betriebliche und regionale Gründe hierfür
- die naturschutzfachliche Bewertung der Greening-Optionen auf Basis ihrer räumlichen Lage (Flächengröße, Bewirtschaftungsart, Standorteigenschaften, Nichtnutzungsdauer, räumlicher Kontext)
- das Entwickeln eines Verständnisses dafür, wie die Bestandsveränderungen von Feldvögeln und die veränderte landwirtschaftliche Landnutzung miteinander zusammenhängen.
Die gewonnenen Ergebnisse wurden, nachdem sie ausgearbeitet und diskutiert wurden, in einem Bericht zusammengestellt, der auch Empfehlungen für die Politik enthält. Der Bericht thematisiert die ökologische Wirksamkeit von ÖVF sowie Aspekte von Kosteneffizienz, Verwaltungsaufwand und die Bedeutung flankierender Instrumente (Beratung, AUKM-Maßnahmen).
Daten und Methoden
Die Umsetzung der Ökologischen Vorrangflächen und die Wirksamkeit von ÖVF in der deutschen Agrarlandschaft wurden mit Hilfe von InVeKoS-Daten untersucht und verfolgt.
Im Rahmen dieses Projekts führte das Institut für Agrarökologie und Biodiversität (IfAB) schwerpunktmäßig die empirische ökologische Feldforschung durch.
Unsere Forschungsfragen
Verändert sich die Bereitstellung von Greening-Flächen über die Zeit? Wie reagieren Landwirte auf wirtschaftliche und natürliche Rahmenbedingungen?
Inwieweit kommt es zu einer Umwandlung von Grün- in Ackerland, um andere Greening-Auflagen zu erfüllen?
Ist die Akzeptanz für die Kombination von Greening-Maßnahmen mit Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) gestiegen?
Wie räumlich stabil sind insbesondere hochwertige ÖVF über die Zeit?
Wie ist die räumliche Einbettung von ÖVF zu bewerten und wie ist die Verteilung?
Welche Auswirkungen haben die 2017 beschlossenen Änderungen im Greening auf das Verhalten der Landwirte?
Lassen sich aus dem deutschen Brutvogelmonitoring Effekte des Greenings ableiten?
Ergebnisse
Die Datenanalysen und Feldbeobachtungen haben gezeigt, dass es aus Sicht des Umweltschutzes einige Verbesserungen durch die ÖVF-Greening-Regelungen gab, allerdings lediglich in sehr begrenztem Umfang. Abgeleitet aus den Ergebnissen empfehlen wir folgendes für die EU-Agrarpolitik:
- Um mehr für die Biodiversität in der Agrarlandschaft zu erreichen, sollten Befreiungen von Landwirtschaftsbetrieben von den ab 2023 in die erweiterte Konditionalität überführten Greening-Verpflichtungen beschränkt werden.
- Es sollte angestrebt werden, ökologisch wertvolle Maßnahmen (off-crop und in-crop; also mit und ohne Nutzung) auf deutlich über 10 % der
Agrarfläche zu etablieren. - Die ÖVF-Maßnahmen (bzw. vergleichbare Nachfolger) müssen anspruchsvoller sein: ökologisch wenig wertvolle Maßnahmen sollten gestrichen werden, andere modifiziert (z. B. kein Pflanzenschutzmitteleinsatz, Förderung von Blühmischungen). Reine Mitnahmeeffekte sollten verhindert werden und die Zahlungen leistungsorientiert erfolgen.
- Ökologisch wertvolle ÖVF (bzw. vergleichbare Nachfolger) müssen auch in Intensivregionen attraktiv sein, um hohen Belastungen der Biodiversität dort entgegen zu wirken.
- ÖVF (bzw. vergleichbare Nachfolger) sind aus der Fünf-Jahres-Regelung der Definition von Dauergrünland auszunehmen, um für Brachen und Streifen längere Standzeiten zu ermöglichen, ohne dass die Ackerfläche zu Dauergrünland wird. Besser geeignet wäre eine Stichtagsregelung, nach der bestehendes Dauergrünland unter die Erhaltungsregelung fällt, nach dem Stichtag neu entstandenes hingegen nicht.
- Neben unproduktiven sollten auch ökologisch sinnvolle produktive Maßnahmen wie der Anbau von Getreide mit erweitertem Saatabstand oder lichtem Getreide stärker gefördert werden.
- ÖVF (bzw. vergleichbare Nachfolger) und AUKM sollten so ausgestaltet sein, dass ihre Kombination für Landwirt*innen attraktiver wird, damit Brachflächen ökologisch weiter aufgewertet werden.
- Um die Wirkung der einzelnen Maßnahmen zu steigern, sollten Beratungs- und Informationsangebote ausgebaut werden.
- Für die ÖVF-Maßnahmen (bzw. vergleichbare Nachfolger) müssen klare Ziele definiert werden.
Der Umfang und die Qualität der Maßnahmen sind die entscheidenden Merkmale, um einen positiven Beitrag zur Biodiversität in der Agrarlandschaft leisten zu können. Dementsprechend sollten Anreize zur großflächigen Umsetzung hochqualitativer Maßnahmen gesetzt werden.
Eine kurze Zusammenfassung der Kernergebnisse findet sich im Project Brief.
Thünen-Ansprechperson

Thünen-Beteiligte
Beteiligte externe Thünen-Partner
- Institut für Agrarökologie und Biodiversität (ifab)
(Mannheim, Deutschland)
Geldgeber
-
Bundesamt für Naturschutz (BfN)
(national, öffentlich)
Zeitraum
8.2017 - 12.2020
Weitere Projektdaten
Projektfördernummer: FKZ 3517 84 0200
Förderprogramm: BMUB - Umweltforschungsplan
Projektstatus:
abgeschlossen
Publikationen zum Projekt
- 0
Baum S, Böhner HGS, Chalwatzis D, Oppermann R, Röder N (2022) Impact of ecological focus areas on achieving biodiversity goals in arable landscapes (ÖVForsch2). Braunschweig: Thünen Institute of Rural Studies, 2 p, Project Brief Thünen Inst 2022/11a, DOI:10.3220/PB1658730721000
- 1
Baum S, Böhner HGS, Chalwatzis D, Oppermann R, Röder N (2022) Wirkung ökologischer Vorrangflächen zur Erreichung der Biodiversitätsziele in Ackerlandschaften (ÖVForsch2). Braunschweig: Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen, 2 p, Project Brief Thünen Inst 2022/11, DOI:10.3220/PB1647852937000
- 2
Baum S, Chalwatzis D, Böhner HGS, Oppermann R, Röder N (2022) Wirkung ökologischer Vorrangflächen zur Erreichung der Biodiversitätsziele in Ackerlandschaften : Endbericht zum gleichnamigen Forschungsvorhaben, 2017 bis 2021 (FKZ: 3517 840 200). Bonn: BfN, 335 p, BfN Skripten 630, DOI:10.19217/skr630
- 3
Baum S, Böhner HGS, Röder N (2021) What are we talking about? Patterns in the implementation of wildflower strips and fallows by German farmers. Verhandl Gesellsch Ökol 50: 314
- 4
Pe'er G, Bonn A, Bruelheide H, Dieker P, Eisenhauer N, Feindt PH, Hagedorn G, Hansjürgens B, Herzon I, Lomba A, Marquard E, Moreira F, Nitsch H, Oppermann R, Perino A, Röder N, Schleyer C, Schindler S, Wolf C, Zinngrebe Y, Lakner S (2020) Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges. People Nature 2(2):305-316, DOI:10.1002/pan3.10080
- 5
Oppermann R, Chalwatzis D, Röder N, Baum S (2020) Biodiversität in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU nach 2020 : Ergebnisse und Empfehlungen aus den Forschungs- und Entwicklungsvorhaben "Naturschutzfachliche Ausgestaltung von ökologischen Vorrangflächen" (OEVForsch I; 2015 - 2017) und "Wirkung ökologischer Vorrangflächen zur Erreichung der Biodiversitätsziele in Ackerlandschaften" (OEVForsch II; 2017 - 2020) [online]. Bonn: BfN, 11 p, zu finden in <https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/Broschu__re-Biodiversitaet_in_der_Gemeinsamen_Agrarpolitik__GAP__der_EU_nach_2020.pdf> [zitiert am 18.08.2020]
- 6
Röder N, Ackermann A, Baum S, Böhner HGS, Rudolph S, Schmidt TG (2019) Small is beautiful? Is there a relation between farmed area and the ecological output? - Results from evaluation studies in Germany : paper prepared for presentation at the 172nd EAAE Seminar "Agricultural Policy for the Environment or Environmental Policy for Agriculture?" ; May 28-29, 2019, Brussels. 15 p